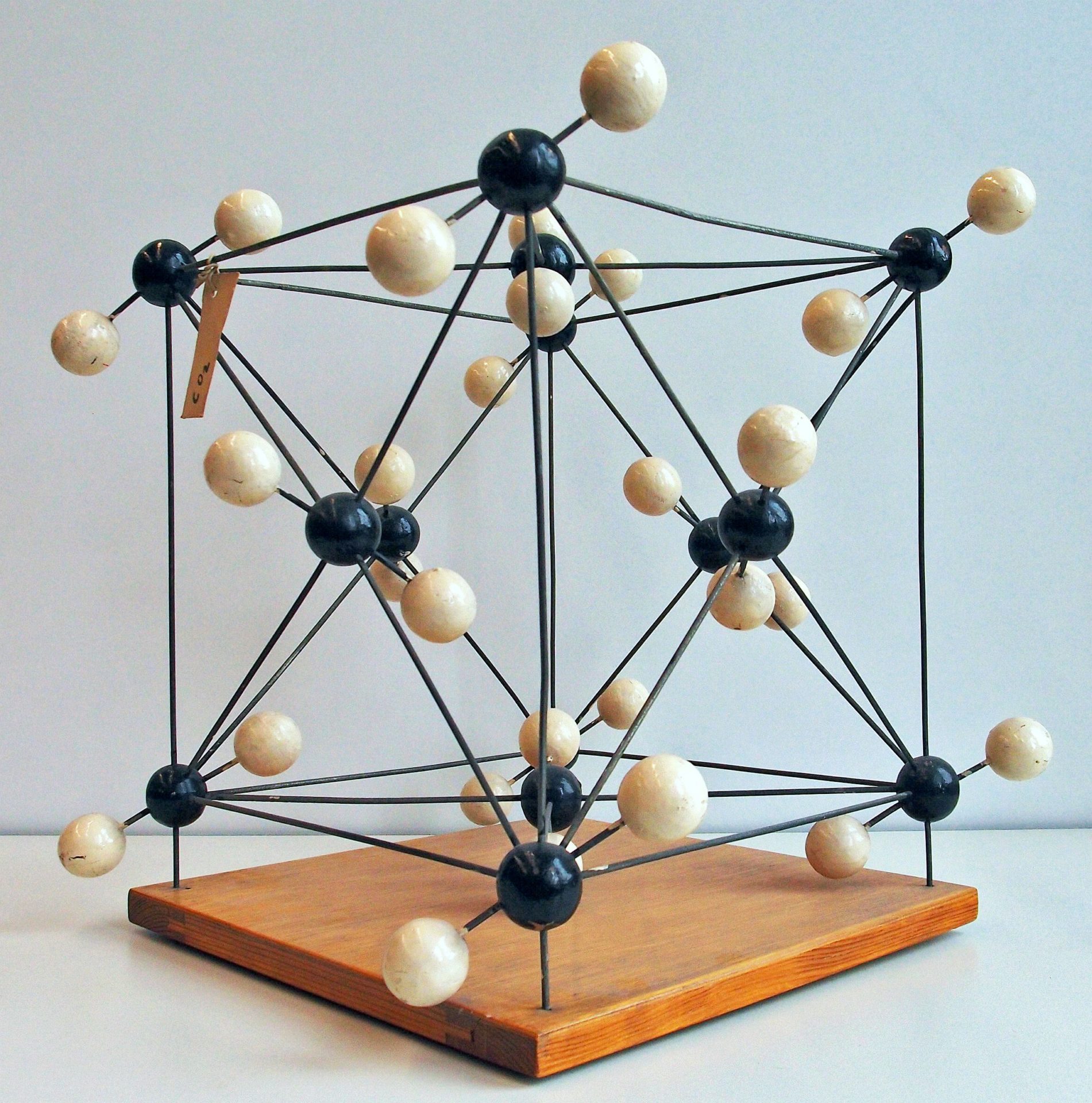Umweltgerechtigkeit
Mitwelt- und Umweltgerechtigkeit
Annette JensenBerlin rühmt sich, als erste Metropole Umweltbelastungen genau kartiert zu haben. In der Broschüre „Die umweltgerechte Stadt“ können alle Bewohner*innen nachschauen, ob in ihrem Viertel der Lärmpegel hoch und die Luft dreckig ist. Auch das Bioklima und die Übernutzung von Grünflächen werden bewertet. Die Karten belegen: Ökofragen sind auch soziale Fragen – denn Quartiere, wo Menschen mit wenig Geld leben, weisen starke Belastungen auf. Ohne Zweifel bilden die Daten eine wichtige Grundlage, um mehr zu tun für benachteiligte Kieze. Doch anzunehmen, dass auf diese Weise eine „umweltgerechte Stadt“ entstehen kann, ist zu kurz gedacht.
Untertan Erde
Begriffe prägen die Wahrnehmung – und Umweltgerechtigkeit klingt erst einmal gut. Tatsächlich zementiert das Wort jedoch Vorstellungen, die die sozial-ökologische Transformation verhindern. „Umwelt“ stellt den Menschen ins Zentrum, die Mit-Welt wird zum Drumherum erklärt. Diese Perspektive liegt bereits der alttestamentarischen Aufforderung zugrunde, sich die Erde untertan zu machen. Als selbsternannte „Krone der Schöpfung“ stellt der Mensch seine Kultur der Natur gegenüber und erklärt sie zur Zivilisation. Menschlicher Geist und willentliche Entscheidungen scheinen den natürlichen Bedingungen enthoben.
Tatsächlich ist es der Menschheit durch den Bau von Hilfsmitteln und Maschinen gelungen, die eigene körperliche Beschränktheit zu überwinden: Leute fliegen mit 800 Stundenkilometern durch die Luft, bewegen gigantische Gesteinsbrocken und können beobachten, was in anderen Erdteilen gerade geschieht. Inzwischen gibt es mehr Tonnen Menschengemachtes als Biomasse, und manche künstlich hergestellte Materialien werden noch in einer Million Jahren existieren. Leider droht vielen Küstenregionen die Sintflut, und die heutigen Kulturleistungen gehen mit immensen Naturzerstörungen einher. Lange galt die Überzeugung, dass diesen Schäden mit neuen Techniken schon beizukommen sein wird. Doch inzwischen dämmert vielen: Wir haben die „Umwelt“ so nachhaltig traktiert, dass das Klima zu kippen droht. Noch wenig im Bewusstsein, aber mindestens ebenso bedrohlich ist, dass auf der Erde das sechste Massenaussterben begonnen hat und die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe existenziell gestört sind.
Parallel zur Zunahme von Schloten und Maschinen, Lärm und Dreck gab es immer auch den Trend, die Natur zu romantisieren: als heilen Sehnsuchtsort, echt, rein und unberührt von menschlichen Einflüssen. In Nationalparks und Schutzgebieten soll konserviert werden, was von sich aus ein ständiger Veränderungsprozess ist. Dort gelten Menschen oft als Eindringlinge – selbst wenn sie in diesen Gegenden schon seit Jahrtausenden im Einklang mit der Natur gelebt haben. Nicht selten wurden indigene Bevölkerungen als vermeintliche Zerstörer*innen vertrieben, weil sie auch Tiere töten. Dass Klimakatastrophe und giftige Emissionen an den Grenzen der Reservate nicht Halt machen, wird in der Tourismus-Reklame wegretouchiert.
Wie wir heute wirtschaften ist Ausdruck menschlicher Hybris – und Dummheit: Ausgraben, nutzen, wegwerfen – so gehen Bergbau, Industrie und Handel mit Rohstoffen um. Sicher, es gibt hier und da ein bisschen Recycling. Doch im Großen und Ganzen herrscht das Prinzip Einbahnstraße. Öl und Kohle werden verbrannt, der darin enthaltene Kohlenstoff entschwebt in die Atmosphäre und heizt das Treibhaus Erde an. Stoffe wie Neodym oder Yttrium enden nicht mehr zugänglich in der Schlacke von Müllverbrennungsanlagen oder in Meeren, obwohl die Industrie ohne diese Metalle keine Smartphones und Computer herstellen kann. „Ach, man hat bisher immer rechtzeitig Ersatzstoffe gefunden“, heißt es dann – und überhaupt: Materielle Güter verlieren wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung, während Dienstleistungen und datenbasierte Produkte immer wichtiger werden für das Bruttoinlandsprodukt. Dass auch die nicht ohne eine materielle Grundlage in Form von Gerätschaften auskommen, gerät aus dem Blick.
Wie es besser geht, zeigt die Wirtschaftsweise der Mitwelt. Seit 3,5 Milliarden Jahren gibt es Leben auf unserem Planeten. Obwohl von außen kein neues Material hinzukommt, hat nicht nur die Vielfalt ständig zugenommen, sondern auch die Biomasse. In der Natur gibt es keinen Müll. Was für die eine Spezies Abfall, ist für eine andere Nährstoff. Mit der Zeit wurde immer mehr unbelebtes Material in die Kreisläufe des Lebens integriert – und das schuf dann immer mehr Möglichkeiten für neue Existenzformen. Bei alledem blieb das Wasser sauber und konnte wieder und wieder genutzt werden. Energielieferant für all diese Prozesse ist die Sonne. Zwar ereigneten sich zwischendurch fünf Katastrophen, bei denen ein Großteil der Lebewesen ausstarb. Doch nach einer Weile kreuchten und fleuchten, kletterten und wucherten jedes Mal mehr Tiere und Pflanzen auf der Erde als je zuvor. Wachstum an sich scheint also kein Problem zu sein – nur so wie wir Menschen es anstellen ist es selbstzerstörerisch. Aber auch wenn wir womöglich den Hungertod von Milliarden und vielleicht sogar unser eigenes Aussterben organisieren: Das Leben wird weitergehen. Wir sind weder die Krone der Schöpfung noch ihr Ende.
Wer mehr Geld hat, macht mehr Dreck
Zu unseren Weltbildern gehören auch Vorstellungen von Recht und „Gerechtigkeit“. Hierbei spielt die Mitwelt so gut wie keine Rolle, es sei denn als Objekt. Zwar hat der Wanghanui River in Neuseeland den Rechtsstatus von Personen erhalten; die Maori hatten argumentiert, der Fluss sei kein Ding, sondern ein Lebewesen. Auch genießt Pachmama – Mutter Erde – in Ecuador offiziell Verfassungsrang. Das aber sind große Ausnahmen. Bei „Gerechtigkeit“ geht es fast immer um eine faire Aufteilung von Gütern und Lasten zwischen Menschen oder menschengemachten Institutionen.
In unserem heutigen Rechtssystem bedeutet Geld den Zugang zu Konsum, aber auch zu Grund und Boden. Auch das Recht, die „Umwelt“ verschmutzen zu dürfen, ist durch den Emissionshandel käuflich geworden. Wer den höchsten Preis zahlt, bekommt ein begehrtes Gut. Damit verbunden ist die Erzählung, dass eine wachsende Geldmenge die wirtschaftlichen Aktivitäten erhöht und damit den Wohlstand aller mehrt – so wie die Flut große und kleine Boote hebt. Doch inzwischen ist nicht mehr zu übersehen, dass dieses Narrativ falsch ist und tatsächlich Gier und Luxus schützt. 26 Reiche besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Die Geldverteilung und die ihr zugrundeliegende Wirtschaftsweise sind extrem ungerecht – und zugleich ruinieren sie den Planeten und graben künftigen Menschen die Lebensgrundlage ab.
Geld bedeutet den Anspruch, Güter und Dienstleistungen erwerben zu können. Weil es inzwischen immer mehr Geld gibt als reale Dinge, sind längst auch Bildung, Gesundheit und Zukunft Waren. Die Reichen kaufen Wohnungen und Ackerland und treiben die Preise in die Höhe, während Milliarden Menschen nichts besitzen und täglich um ihr Überleben kämpfen. Der Kapitalismus spaltet die Gesellschaften in wachsendem Maße.
Doch nicht nur der Wohlstand, sondern auch die Belastungen sind extrem ungleich verteilt. Wo es lärmt und stinkt, Wasser und Luft stark verdreckt sind, wohnen keine Reichen. Wer an einer Hauptstraße oder neben einer Fabrik lebt, stirbt im Durchschnitt deutlich früher. Das ist heute in der Regel gemeint, wenn „Umweltgerechtigkeit“ thematisiert wird – und so versteht es auch der Berliner Senat.
Wohlhabende beanspruchen nicht nur große Mengen an Ressourcen und können es sich leisten, den dadurch verursachten Problemen zu entfliehen. Es gibt noch eine dritte Korrelation beim Thema Vermögen und „Umwelt“: Wer mehr Geld hat, macht mehr Dreck. In Deutschland sind die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung für mehr klimaschädliche Gase verantwortlich als die gesamte ärmere Hälfte, hat Oxfam ausgerechnet. Anders gesagt: 8,3 Millionen Leute haben das Treibhaus Erde mit ihrem opulenten Lebensstil so stark angeheizt wie 41,3 Millionen andere.
Profite werden verschleiert
Die grundlegenden Ursachen für die Zerstörung der Mitwelt und für die soziale Spaltung sind identisch. Trotzdem erscheinen soziale und ökologische Interessen in vielen Diskussionen als Gegensätze. Fridays for Future wird als Bewegung von Bürgerkindern abgekanzelt, und Bioläden gelten als Orte für Besserverdienende. Das ist ja auch nicht falsch. Tatsächlich reichen die Hartz-IV-Sätze nicht aus, um sich ausgewogen zu ernähren; 1,65 Millionen Menschen in Deutschland sind auf Lebensmittel von den Tafeln angewiesen. Zugleich gibt es aber auch Empörung in die umgekehrte Richtung. Die Verantwortung über gequälte Schweine und die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen wird Konsument*innen angelastet, die billiges Nackensteak auf ihren Grill packen. Und die Bild-Zeitung geriert sich als Interessenvertreterin dieser „kleinen Leute“, denen grüne Politiker*innen angeblich das Essen vom Teller nehmen wollen.
Solche Vorwürfe und gegenseitigen Zuschreibungen aber verdecken und verschleiern, was die ökologischen Katastrophen weiter verschärft: ein profitgetriebenes Wirtschaftssystem, das immer mehr Waren auf den Markt drückt – koste es für Mensch und Mitwelt, was es wolle. So wurde die Aldi-Familie zum reichsten Clan in Deutschland. Eine Erbin aus dem Discounter-Imperium hat kürzlich viel Ackerland in Ostdeutschland gekauft und kassiert nun jährlich auch noch 3,5 Millionen Euro EU-Subventionen. Durch Landgrabbing haben sich die Pachten in Ostdeutschland in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Zugleich drücken Lidl, Aldi, Edeka und Rewe die Preise für Milch, Fleisch und Brot nach unten. Immer mehr Bauern mussten aufgeben. Übrig bleiben kapitalintensive Großbetriebe, die mit landwirtschaftlicher Intensivproduktion das Artensterben und die Klimakatastrophe befördern.
Ökologie first
Bereits 1972 hatte der Club of Rome darauf hingewiesen, dass wir auf dem Weg in den Abgrund sind. Auch deshalb wurde in den 1980er Jahren das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ als vermeintlicher Ausweg populär: Wirtschaft, Umwelt und Soziales sollten in ein Gleichgewicht gebracht werden. Einen Bruch mit der Vorstellung, dass der Mensch denkt und lenkt und die „Umwelt“ eine Variable ist, war das freilich nicht. Inzwischen ist zumindest vielen in der jüngeren Generation klar, dass die Mitwelt kein Verhandlungspartner ist, sondern die Basis unseres Lebens. Für alle, denen das zu abstrakt ist: Wenn ein Haus in Flammen steht, macht es keinen Sinn, den Bewohner*innen neue Möbel verkaufen zu wollen oder über die Verteilung der Zimmer zu streiten. Als erstes muss das Feuer gelöscht werden. Also: Ökologie first.
Was heißt das konkret? Die Art und Weise, wie wir wirtschaften und die Dinge untereinander verteilen, darf die Mitwelt nicht ignorieren. Wir sind Teil der Natur und können nur überleben, wenn wir uns einfügen. Es gilt unseren Geist zu nutzen, um die Wirtschaftsweise der Natur zu imitieren: Abfälle sind Rohstoffe für eine überwiegend regionale Produktion. Es kommen keine Materialien und Techniken zum Einsatz, die für das Leben langfristig und großflächig zerstörerisch wirken. Die Sonne liefert die Energie. Das Wasser ist so zu behandeln, dass es trotz vielfältiger und ständiger Nutzung sauber bleibt. Monopole und Eigentum an Grund und Boden gibt es nicht, alles ist Open Source und gehört denjenigen, die gerade da sind und es nutzen. Unter solchen Umständen ist auch Wachstum kein Problem, wie der schon 3,5 Milliarden Jahre andauernde Entwicklungsprozess der belebten Natur belegt.
Auch soziale Gerechtigkeit ist nur möglich, wenn wir die Mitwelt nicht grundlegend schädigen und sie im besten Fall sogar fördern. Was wir jetzt brauchen sind Visionen vom Leben im Einklang mit den planetaren Grenzen. Dafür bedarf es Wissen, Kreativität und integrierte Ansätze. Das aktuelle Wirtschaftssystem existiert seit etwa 250 Jahren, ist menschengemacht und kann folglich auch von Menschen verändert werden.
Viele Bausteine für eine gute Zukunft sind längst da – doch sie bleiben in der Nische, weil die gegenwärtigen Strukturen eine zerstörerische Lebensweise fördern und zementieren. Der Berliner Ernährungsrat zeigt in seinem Buch „Berlin isst anders“, warum die Metropolregion das Potenzial hat, Vorreiter zu werden für eine Ernährungsweise, die sozial gerecht ist und vereinbar mit den Belastungsgrenzen der natürlichen Systeme. Was es braucht ist ein Zusammenwirken von Menschen mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Kenntnissen. Berlins Bevölkerung hat vielfältige Wurzeln und Herkünfte – das ist ein großer Schatz. Hervorragende Forschungsstätten, Initiativen und Organisationen sind in Berlin-Brandenburg ansässig. Wenn all ihr Wissen zusammenfließt, gibt es vielleicht die Chance, dass die Transformation gelingt. Deshalb fordert der Berliner Ernährungsrat, einen Ernährungscampus einzurichten – einen offenen Ort, wo viele Menschen gemeinsam und experimentell die Zukunft diskutieren, erproben und entwickeln.