»Home« / Zuhause
Home Sweet Home –Das Zuhause und die Neuordnung des Privaten
Sarah Speck, Lilian HümmlerDas Zuhause ist durch Lockdown, Energiekrise, Immobilienpreise, Gentrifizierung und digitale Entwicklungen – Stichwort Smarter Homes und Home-Office – sowie durch Landflucht und andere Fluchtbewegungen erneut in den Fokus gesellschaftlicher Debatten gerückt. In der kulturellen Ordnung der bürgerlichen Moderne ist das Zuhause mit einem bestimmten Sinn versehen: Es steht für das Private, die Zuflucht vor staatlichem Zugriff und gesellschaftlichen Zumutungen, für den geschützten Selbstausdruck, Authentizität und Emotionalität, kurz: für einen, wenn nicht den Ort des Wohlbefindens – Home Sweet Home. Die aufgerufenen Debatten verdeutlichen, wie voraussetzungsreich und wie wenig selbstverständlich eine solche Stätte ist. Angesichts der Effekte des Finanzmarktkapitalismus auf die Eigentumsstruktur in Städten und im Kontext der gegenwärtigen Migrationsregime ist die Frage des Zugangs zu Räumen, die man sein Zuhause nennen könnte, gegenwärtig höchst virulent. Wer wie wo und mit wem zusammenlebt, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren des Sozialen ab, ebenso die Frage, wer sich zu Hause fühlen, also wer das mit diesem Ort einhergehende kulturelle Versprechen affektiv realisieren kann. Das Zuhause hat folglich wesentlich mit Fragen der Exklusion zu tun.
Das weiß auch die Geschlechterforschung, für die das Zuhause eine genuin ambivalente Lokalität ist. Im Zuge der Sphärentrennung unserer modernen, kapitalistisch strukturierten Gesellschaftsordnung, wurden die private Sphäre und das Häusliche weiblich codiert (Hausen 2007 [1976]) und damit zumindest bestimmte Frauen – bürgerlich, weiße, verheiratete – zugleich von der Öffentlichkeit und der Erwerbsarbeit exkludiert. Frauen aus den unteren sozialen Lagen mussten ohnehin einen Lohn erwirtschaften, um sich und diejenigen, für die sie Sorge trugen, zu ernähren – teils in den Haushalten anderer Frauen. Für die Geschlechterforschung ist das Zuhause ein Raum der abgewerteten, wenngleich gesellschaftlich notwendigen reproduktiven Arbeit, der verdeutlicht, dass Kapitalismus als Lebensform wesentlich durch Geschlechterverhältnisse vermittelt ist. Und, obgleich er der Führung durch Frauen unterliegt, auch einer, an dem die männliche Herrschaft sich zu stabilisieren vermag, und zwar nicht nur, aber auch mittels sogenannter häuslicher Gewalt (exemplarisch Hümmler/de Andrade 2020). Das Zuhause ist also kein sicherer Ort, weder für Kinder, noch für Frauen oder für jene, die sich jenseits klassischer, heterosexistischer kultureller Anforderungen verorten. Für Letztere ist das familiäre Zuhause aufgrund von Abwertung der eigenen Lebensweise häufig das genaue Gegenteil einer Zuflucht des Wohlbefindens, beziehungsweise muss ein anderes Zuhause über alternative familiäre Konstellationen und andere Beziehungsweisen neu hergestellt werden. Denn zugleich bleibt es für viele auch ein Sehnsuchtsort, der das Versprechen birgt, so zu leben und zu lieben, wie man es sich wünscht.
Insbesondere die Covid-Pandemie offenbarte spezifische Dynamiken im und um das Zuhause. „Stay home“ – „bleib zuhause“ war die erste und dringlichste Verordnung nach Ausbruch der Pandemie. Dieser erstmal virologisch begründete und einfach daherkommende Appell stellte nahezu alle Menschen vor große Herausforderungen, und tat dies global betrachtet in unterschiedlichen Kontexten auf sehr unterschiedliche Weise. In Deutschland waren die konkreten Regulierungen zur Eindämmung der Pandemie dabei etwa von bestimmten normativen Vorstellungen geleitet: Wir alle haben ein Zuhause, und dort wohnen wir gemeinsam mit jenen Personen, mit denen wir Nah-, Sorge- und Liebesbeziehungen führen. Diese Annahme verfehlte die Lebensrealität sehr vieler Menschen.
In unserem Projekt zur „Neuordnung des Privaten“ haben wir1Außer uns beiden war Bea Ricke Teil des Projektteams. bereits im März 2020 32 problemzentrierte Telefon-Interviews und ein self-recording mit Menschen in ganz unterschiedlichen Haushaltskonstellationen geführt, um die Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu untersuchen. Die explorative Studie folgte dem Prinzip maximaler Kontrastierung: Das Sample umfasst vielköpfige Haushalte und Alleinlebende, der Norm entsprechende Kleinfamilien und über mehrere Haushalte verteilte Sorgegefüge, Menschen mit und ohne Aufenthaltsgenehmigung, Beschäftigte im Home-Office und in sogenannten systemrelevanten Berufen, von Arbeit Freigestellte und Erwerbslose. Die Vielfalt der häuslichen Erfahrungen in unserer soziokulturell heterogenen Gesellschaft zeigte sich bereits zu Beginn der Pandemie. Die Ausnahmesituation kurz nach den ersten Beschränkungen stellte sich für die von uns Befragten ganz unterschiedlich dar. Insbesondere für unsere Interviewpartner*innen aus den mittleren sozialen Lagen in nicht-systemrelevanten Berufen waren die ersten Wochen ein plötzliches Aus-der-Zeit- und Aus-dem-Takt-Fallen, sodass eine Reflexion über die „Normalität“ des Alltags im neoliberalen Ausnahmezustand und die regulären Anforderungen ihres Lebens einsetzte. Für viele ging damit ein anderes Sich-Zuhause-In-Beziehung-Setzen einher: Eine Interviewpartnerin berichtete vom allabendlichen Kartenspielen mit ihren jugendlichen Kindern, eine Praxis, die sie sonst nur im Urlaub ausüben würden; ein anderer davon, dass er erstmals mitbekäme, worin die Erwerbsarbeit seiner Frau eigentlich bestehe.
Andere Interviewte schilderten, dass der verordnete Ausnahmezustand die alltägliche Lebensführung eigentlich kaum verändert und stattdessen vielmehr zu einer Angleichung des inneren Erlebens mit der äußeren Realität geführt habe. So etwa Irina Kuhn*, die unter anderem aufgrund der intensiven Pflegebedürftigkeit ihres 30-jährigen Sohnes nicht erwerbstätig ist und im Transferbezug lebt. Ihre ohnehin finanziell prekäre Situation, in der sie auf den Cent genau alle monatlichen Ausgaben kalkuliert, habe sich verschärft, da sie durch die „dumme Hamschterei” zu teureren Produkten greifen müsse, beklagt sie. Davon abgesehen stelle sich ihr Alltag kaum anders dar:
IK: Also verändert hat sich bei uns äh vom äh ähm ähm vom Sozial- vom Soziale eigentlich nix. Da man niemande mehr sehen dürft, ischt keine Familie mehr da. Wir sind allein, mein Sohn und ich. Also von dem her hat sich da nix verändert. Ich genieß‘ es. Mit dem Abstand. Zu anderen Menschen.
I: Inwiefern?
IK: Ich bin eh ’n Einzelgänger. Also ich bin sehr, sehr gern alleine. Komm‘ sehr gut mit mir selber klar. Meine drei Freunde – sehr, sehr gute Freunde, mit dene steh‘ ich in Kontakt äh telefonisch. Ähm. Ja äh weil I noch e Hund hab‘, moi eine Freundin mit Hund, mir treffen uns auch auf Abstand. Spreche miteinander und gehen e paar Meter. Also von dem her, das macht mir jetzt nichts. Ich genieß es. Diese reschpektvolle Abstand. Dass mir keiner ins Genick schnauft.
Ihren Alltag hat Frau Kuhn auch vor der Pandemie im Wesentlichen in ihrer Wohnung verbracht. Sie verlässt diese in der Regel nur für Spaziergänge oder Einkäufe, die sie hinauszögert, da sie, so sagt sie, im Laden versucht sei, Geld auszugeben – alle 10 bis 14 Tage ginge sie einkaufen.
Ganz anders und doch sehr ähnlich stellt sich die pandemische Situation für einen aus Afghanistan geflüchteten Mann ohne dauerhafte Aufenthaltserlaubnis dar. Der 37-jährige Khaled lebt seit 7 Jahren mit einer sogenannten Duldung in Deutschland, derzeit in einem WG-Zimmer in einer Großstadt. Der verwaltungsgerichtliche Prozess der unsicheren Verlängerung seines Status, erklärt Khaled, stürze ihn zyklisch, jedes Jahr, in eine mehrmonatige Krise, die seine posttraumatische Belastungsstörung vergrößere und zu einem noch stärkeren sozialen Rückzug führe. Er halte sich hauptsächlich in seinem WG-Zimmer auf. Khaled betont, der digitale Kontakt zu Familienangehörigen und Freund:innen, die sich in Geflüchtetencamps oder noch in Afghanistan befinden, sei wesentlich für seinen Alltag, den er als „limbo“ bezeichnet. Neben den Mahlzeiten sei dieser nur durch therapeutisch verordnete tägliche Bewegung strukturiert. Der Lockdown verändere an dieser Alltagsführung nichts, meint Khaled. Allerdings beschreibt er:
As the entire city shut down, I experienced a sense of… sort of taking a breath for the first time in many years. My life is on hold because of the wait for the residency. (…) So as the city shut down, everything felt like on hold, similar to my life, which for the first time massively reduced the constant worrying and embarrassement (…).
Die Tatsache, dass einige Fälle in unserem Sample, so wie gesamtgesellschaftlich sicherlich viele marginalisierte Menschen, den verordneten Rückzug ins Zuhause nicht als Ausnahmezustand, sondern als Fortsetzung ihres Alltags, aber auch als psychische Entlastung erlebt haben, gibt Aufschluss über unterschiedliche Herausforderungen in unserer heterogenen und ungleichen Gesellschaft nicht nur während der Pandemie, sondern auch im „Normalzustand“. Und sie verdeutlicht, dass Exklusionserfahrungen und eingeschränkte Teilhabe auch wesentlichen Einfluss auf die Konstitution des Zuhauses haben – aufgrund ökonomischer Bedingungen, aber vor allem auch aufgrund von Zeit- und Raumstrukturen, die mit eben diesen Bedingungen einhergehen. Schon die kanonische Studie zu den „Arbeitslosen von Marienthal“ (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 2020 [1933]) zeigte, mehrfach durch verschiedene Forschungen bestätigt, dass gesellschaftliche Exklusion zu einer „Schrumpfung des Lebensraums“ (ebd.) und zu einem tendenziellen „Zusammenbruch der Zeitstruktur“ (ebd.) führt – wobei hier ein signifikanter Geschlechterunterschied herausgestellt wurde: Der Alltag der Frauen war durch Sorgearbeit getaktet, die, je mehr sich die Ressourcen verknappten, umso aufwändiger wurde. In den zwei hier kurz vorgestellten Fällen ist die Lebensführung auch jenseits der Pandemie auf das Zuhause reduziert. Dabei ringen beide Interviewpartner*innen um eine Zeitstruktur in ihrem Alltag, mit wenigen Orientierungspunkten: Mahlzeiten und das Verlassen des Hauses, ein, zwei, drei Mal am Tag, nur, um sich nicht permanent in der Wohnung aufzuhalten.
Ganz anders das Aus-dem-Takt-Fallen der Interviewpartner*innen aus den mittleren sozialen Lagen, insbesondere in mehrköpfigen Wohnkonstellationen mit Sorgeverpflichtungen. Ihr „normaler“ prä- und postpandemischer Alltag ist hyperstrukturiert und wesentlich dadurch geprägt, dass sie sich die meiste Zeit gar nicht in ihrer Wohnung aufhalten. Und es ist gerade diese Abwesenheit, die das Zuhause zu so einer komplexen Lokalität macht, in der sich die dort Lebenden immer wieder neu zueinander in Beziehung setzen müssen. Zugleich muss das Zuhause für die Zeit, in der alle diesen Raum teilen, durch eine Vielzahl von Praktiken als ein Ort des Wohlbefindens hergestellt und aufrechterhalten werden. Gemeint sind jene Tätigkeiten, die, so wissen wir aus der Geschlechterfoschung, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch im Häuslichen kaum verhandelt und augenscheinlich von unsichtbaren Händen verrichtet werden. Deutlich wurde im Kontext der Pandemie jedoch auch, wieviele dieser Tätigkeiten inzwischen gänzlich ausgelagert werden oder – vielfach durch Plattformen vermittelt – von Menschen in einem Zuhause verrichtet werden, das nicht das ihre ist. Die In-Wert-Setzung des Privaten war wesentlicher Bestandteil von Prozessen der Umgestaltung des Kapitalismus in den letzten Dekaden. Gegenwärtig stellt sich in diesem Zusammenhang unter anderem die Frage: Wer arbeitet alles unter welchen Bedingungen – bezahlt und unbezahlt – daran mit, dass ein Zuhause aufrechterhalten bleibt?
Von der Perspektive der Tätigkeiten ausgehend, die es dazu bedarf, sind die Grenzen des Zuhauses nach außen also porös – historisch, wie auch aktuell. Umso wichtiger erscheinen kulturelle Praktiken der Grenzziehung, die die private Sphäre wiederherstellen. Im Kontext der Pandemie wurden diese Praktiken für breite Bevölkerungsschichten relevant, insofern sehr viele ihre Erwerbsarbeit in der Wohnung verrichten mussten. Wann und wo beginnt das Zuhause? Es mussten Zeit- und Raumstrukturen entwickelt werden, die diese Grenze markierten – insbesondere für jene eine Herausforderung, die gleichzeitig mit der häuslichen Betreuung und Beschulung von Kindern konfrontiert waren. Auch hier zeigten sich geschlechtliche Muster: Es waren vor allem Frauen, die den Löwinnenanteil der Sorgearbeit leisteten. Aber es gab auch ein anderes frappantes Muster, das sich in qualitativen Studien in unterschiedlichen Ländern (Waismel-Manor et al 2021; Chauhan 2022) und auch in unserem Material zeigte: Von den 33 Haushalten in unserem Sample setzten sich sieben aus je einem heterosexuellen Paar mit Kindern zusammen, bei denen beide Elternteile erwerbstätig waren und im Home-Office arbeiteten. In all diesen Fällen gab es eine räumliche Priorisierung der Arbeit des Mannes, d.h. ihm stand in der Praxis ein Vorrecht auf ein verschließbares Zimmer zu. Die Frauen arbeiteten bei Raumknappheit entweder am Küchen- oder Esstisch, während die Kinder ebenfalls dort oder in ihrem Zimmer Schulaufgaben machten, oder sie wechselten selbst ins Kinderzimmer. Auch durch solche unsichtbaren, teils unbewussten Grenzziehungen wird die symbolische und geschlechtliche Ordnung fortgeschrieben. Es ist der Raum für sich selbst (Woolf 2019 [1929]), der, wenn es kritisch wird, in der sich kulturell fortschreibenden, geteilten Geschlechterordnung eher Männern zugesprochen oder ganz selbstverständlich von ihnen ergriffen wird. Es lässt sich folglich auch im Zuhause eine Arbeit an Grenzen beobachten, die mit historischen und sich fortsetzenden Dynamiken gesellschaftlicher Exklusion und Teilhabe zu tun haben.
Das Zuhause ist zeitdiagnostisch aber noch in einer anderen Hinsicht von Interesse: Auch die neuen digitalen Technologien und die Kommodifizierung des Privaten fordern die Bedeutungen und porösen Grenzen der „eigenen“ Räume und die kulturellen Praktiken zu ihrem Erhalt in neuer Weise heraus. Über Plattformen, am bekanntesten AirBnB, kann das Zuhause an Unbekannte temporär vermietet werden. Das Zugänglich-Machen und die Inszenierung der eigenen vier Wände ist ferner wesentlicher Bestandteil relativ neuer, aber keineswegs marginaler kommerzieller Tätigkeiten im Internet. Für die Darbietung des vermeintlichen Alltags stellen die sozialen Medien niedrigschwellig die Möglichkeiten bereit, sei es in einem mittlerweile weiten pornographischen Feld, in dem nicht nur sexuelle Handlungen profitabel gemacht werden, sondern auch die ganz normale „intime“ Lebensführung, oder im Sinne der Eigenwerbung von Influencer*innen oder Versuchen der Selbstvermarktung Nicht-Prominenter. Die Präsentation des Zuhauses ist relevanter Bezugspunkt für die Inszenierung von Authentizität. Der Raum für sich selbst wird im Kontext der digital vermittelten Ökonomisierung von Intimität in spätmodernen Gesellschaften auf bisher ungekannte Weise zu einem Raum für andere.
Pierre Bourdieu hat in seiner erweiterten Ökonomie der Praxisformen (1987 [1982]) und in seinen Studien zum Einzigen und seinem Eigenheim (2002 [2000]) herausgearbeitet, inwiefern das Zuhause ein Kristallisationspunkt materieller Investitionen und damit auch einer der intergenerationellen Reproduktion von sozialer Ungleichheit ist. Solche Analysen, aber auch Studien zu Praktiken der Distinktion und selbstverständlich die Einsätze feministischer Ökonomiekritik unterstreichen die soziale und besonders auch die wirtschaftliche Bedeutung des Zuhauses. Doch lohnt es sich zu untersuchen, inwiefern und durch welche Praktiken es auf neue Weise zur ökonomischen Ressource wird, in dem – je nach sozialer Position auf unterschiedliche Weise – die Grenzen, die das Zuhause umschließen, gezielt geöffnet werden.
* Name anonymisiert
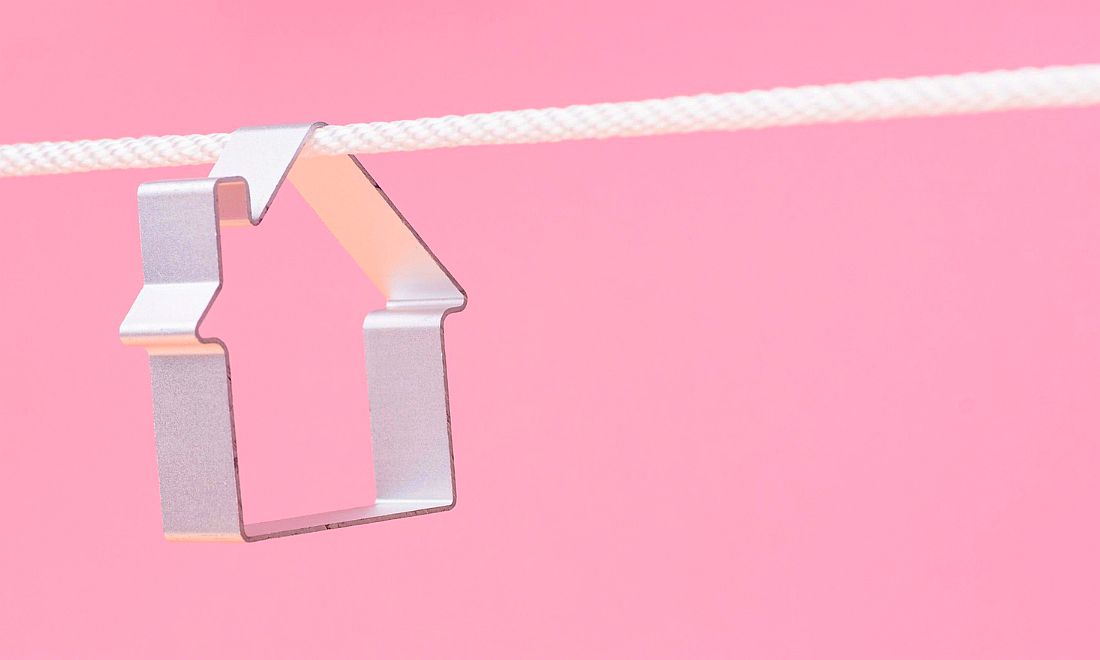
Literatur
- Bourdieu, Pierrre 1987 [1982]: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, Pierre 2002 [2000]: Der Einzige und sein Eigenheim. Hamburg: VSA-Verlag.
- Chauhan, Priyanshi 2022: „I Have No Room of My Own“: COVID-19 Pandemic and Work-From-Home Through a Gender Lens. Gend. Issues 39, 507–533.
- Hausen, Karin 2007 [1976]: Die Polarisierung der Geschlechtercharaktere. In: Hark, Sabine (Hrsg): Dis/Kontinuitäten. Feministische Theorie. Wiesbaden: VS, S. 173-196.
- Hümmler, Lilian und Marilena de Andrade 2020: Wenn Krise auf Krise trifft: die weltweite Epidemie geschlechtsspezifischer Gewalt in Zeiten von Corona. In: Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 2/2020, S. 127–128.
- Jahoda, Marie, Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel 2020 [1933]: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Frankfurt am Main und Leipzig: Suhrkamp Verlag.
- Redaktion Prokla 2016: Der globale Kapitalismus im Ausnahmezustand. In: PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, 46(185), 507–542.
- Waismel-Manor, Ronit; Wasserman, Varda; Shamir-Balderman, Orit 2021: No Room of her Own: Married Couples‘ Negotiation of Workspace at Home During COVID-19. Sex Roles, 85(11-12): 636-649.
- Woolf, Virginia 2019 [1929]: A room of one’s own. Berlin: Insel Verlag.
Fußnoten
- 1Außer uns beiden war Bea Ricke Teil des Projektteams.
